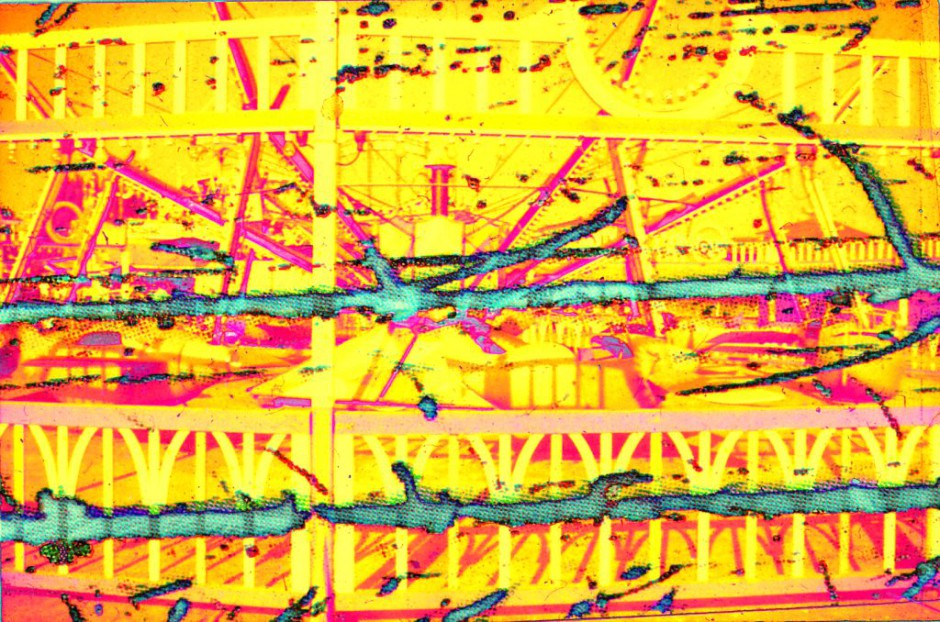In den Tiroler Bergen*
Das Margaretenkirchlein im Salzkammergut. Sein Turm: sehr einsam in der Weite des Tales, rot, zwischen Ziegel und Fliegenpilz. Im Glockenstuhl saß früher der Landvogt. Von weither schwärmten die Brieftauben ein und die bestechlichen unter ihnen ließen gegen eine Handvoll gelber Maiskörner, mit denen der Mann sie durch die Schalllöcher lockte, gern ihre geheimen Depeschen und Kassiber zurück. Heute hat sich im Glockengestühl, vom knarrenden Uhrwerk umrankt, ein Mensch aus dem Geheimdienst platziert. Er arbeitet vollautomatisch und rund um die Uhr, elektronisches Gedankenschaltwerk, füttert Daten wie Kartoffelchips ein. Die Atmosphäre und ihre Frequenzen erzittern und beben unter seinem Zugriff. Niemand und nichts kann ihn hindern. Die Sache im Turm ist Top secret. Unten eine Zwiebel, nach oben hin läuft er geschwind zu, bis er die Spitze einer Nadel erlangt hat und sich durch die Messblätter und Generalkarten bohrt, die die Kartographen im fernen Europa ahnungslos vor sich ausbreiten.
Das Tennengebirge steckt voller Hohlräume. Du wanderst und wanderst und selbigen Tages bist du verschwunden. Die Berge sind inwendig hohl wie ein Sparschwein, ihre Außenseite mit zahllosen Schlitzen versehen. Eine trügerische Vegetation aus Rhododendron (den man deswegen auch Almenrausch nennt), wuchernder Baumheide und Krummholzgebüsch verbirgt den tückischen Spalt und lässt den Sturz in die Tiefe so plötzlich einsetzen, dass man, ehe die Besinnung eintritt, schon zwischen dem Wurzelwerk durch ist. Der rettende Griff geht ins Leere. Wenn keiner im Tal ist, der dich vermisst, dauert es Jahre, bis jemand durch Zufall dich findet. Das ohnehin kaum beschädigte Buschwerk wächst, weil dem trügerischen Gelände hervorragend angepasst, ziemlich schnell nach und bietet eine vollendete Tarnung. Unter dieser Voraussetzung könnte es sein, dass einer genau in denselben Riss tritt, zwischen glatten Wänden hinabstürzt und sich zu deinen verblichenen Knochen gesellt. Eine Wahrscheinlichkeit – sie lässt sich in keinem Kopf errechnen.
Der hufeisenförmige Kamm zwischen Zipharspitze und Halderjoch ist noch nie so beschrieben worden, wie er wirklich aussieht. Drei Stunden benötigt man für den Anstieg zur Palseralm. Von dort ist der Kamm zwar zu sehen, aber wer schon einmal drüben war, auf der anderen Seite, wo die Reste eines späteiszeitlichen Gletschers herumliegen, bringt die Anblicke nicht zusammen. Denn von drüben zeigt er sich hohl, wie ausgefräst, eine immense Kuhle voll zertrümmerter Bergwände, von hüben eher behaglich, obwohl auch das täuscht. Denn Brennnesselfelder und Kletten wetteifern darin, den Bergfreund, der den Kamm voll ins Auge fassen will, keinen Schritt über die Alm hinauszulassen.
Der Lötschtaler Höhenweg zieht sich von Hütte zu Hütte. Bei Sonnenschein lässt er sich in Holzpantinen bewältigen. Aber im Handumdrehen schlägt das Wetter hier um. Urplötzlich herrscht finstere Naht. Kein Regen, keine Kälte, kein Lüftchen regt sich. Aber die Dunkelheit ist gewaltig und erfüllt mit dem Klappern des hölzernen Schuhwerks. Das sind die Verirrten, die auf dem Höhenweg tappen und ihn trotzdem nicht finden, verloren zwischen Hütte und Hütte. Jede Baude ein Bollwerk für die, die am Höhenweg seit Jahrhunderten wurzeln, eine Zuflucht für sie und niemanden sonst. Fenster und Türen verrammelt wie Festungen. Kein Lichtstrahl tritt zwischen die genagelten Balken und Bohlen hindurch. Die drinnen haben, um sich vor dem Einbruch der Dunkelheit zu schützen, alle Ritzen mit Bergmoos und Kuhdung verstopft. Von den Toren, die im erzwungenen Blindekuhspiel über den Höhenweg tappen, lassen sie keinen herein.
Der Lötschtaler Höhenweg führt nicht, wie so viele andere schreckliche Routen, zwischen Abgrund und Abgrund entlang. Genau das macht er nicht, sondern ausladend zwischen Baude und Baude. Bei Sonnenschein ist alles sehr gastlich, wie mit dem Munde gemalt. Aber in der Finsternis lauern die Hütten den Pantinenträgern aus Holz auf, wie die Klippen den steuerlos treibenden Schiffen. Es gibt einen harten Schlag zwischen Hüttenkante und Stirn. Jemand fällt draußen in der Finsternis um. Aber die in der Bude bleiben mucksmäuschenstill und geduckt im spärlichen Schein ihres Lichts. Die Bergwacht von Lötsch kann es ebenfalls hören, aber die wissen aus lauter Erfahrung, dass Ausrücken keinerlei Sinn hat und fahren in ihrer Stammkneipe beim Kartenspiel fort.
Das großräumige Höhlensystem unterm Gottesacker von Pruchtling hat schon viele gelockt. Aber es gibt nur einen einzigen Eingang, den nur die Einheimischen wissen. Er befindet sich hinter dem Bildstock des Jeremias Zwetsch, der Anno 1733 beim Fällen einem Steinschlag erlag. Die Fremden neigen dazu, mit Schaufeln, die sie im Combi mitbringen und mit Eispickeln, die das Erdreich wie Butter auftun, ihren eigenen Eingang zu suchen. Binnen einiger Tage sind sie ans Ende ihres eigenen Stollens gelangt und jubeln auf, wenn sich auf einmal vor ihnen der Höhlenraum auftut, mit Tropfsteinen wie ein riesiger Wald aus versteinerten Strünken. Ein Triumphschrei, der zu den Pruchtlingern, die oben wieder einmal die Gräber ihrer Verstorbenen pflegen und aus den Beeten die Sternmieren ziehn, fern und dumpf wie ein Stöhnen empordringt. Die stehen dann in aller Gemächlichkeit aus ihren gebückten Verrichtungen auf und bekreuzigen sich, während unter ihnen der frisch geschlagene Stollen einsackt und bis zur Auferstehung der Toten keinen mehr rauslässt.
Hinterm Bildstock des Zwetsch, da kann man sich abseilen. Aber unterm Gottesacker ist es so ungeheuer verzwickt, dass man die in die Tiefe Verschlossenen – wenn überhaupt – erst nach Jahren auffinden könnte.
Dann ist der Jüngste Tag nicht mehr fern und bis dahin rette jeder seine eigene Seele.
Von Gipfel zu Gipfel, alles am Grat. Von Ortschaft zu Ortschaft, alles am Seil. Denn nicht jeder erträgt den Schwindel, den der zwischen den Trollblumen und gelbblühenden Frühsommerwiesen dahinschwimmende Bach aus den firnglänzenden Höhen herabzieht und ausströmt. Bedeutende Persönlichkeiten, klangvolle Namen sind da glucksend im Gluckern des Baches vergangen. Ihre Taten sind zerstückelt wie das Katzensilber, das die Forellen mit ihren Bäuchen aufwirbeln. Und ihr Leben, das ihrerseits teils als Zinne, teils als Kammer im schwindelerregenden Eispalast stand, rinnt nun aufgelöst zwischen den Herden der wiederkäuenden Kühe, die unter gepflegten Decken im Gras lagern und ihre rehbraunen Augen zu den Gattern erheben, die sich öffnen, immer dann, wenn der Melker mit dem Tankwagen kommt.
Gibt es einen Sinn in die Berge zu fahren? Der Mann aus der Küchengartenstraße oder im Hochhaus am Holsteiner Platz studiert Karten, reiht sich in die Schlangen am Schalter, unterschreibt und gibt Geld ab, zieht aus phantastischen Prospekten Auskünfte ein. Das alles ist mit viel Lauferei, Zeitaufwand und Illusionen verbunden, die einer, der Bergtourist werden will, dann schon beim Einstieg in den Karwendelexpress wieder ablegen muss.
In der Schulung am Fuße des Lindener Bergs gibt es zwar vieles, was der alpinen Erfahrung vorauseilt (die Lindener Alpen zum Beispiel, ein zerklüftetes Schrebergelände), und anderes, etwa der Fernblick Richtung Deister und Ith, was die aufwendige Anfahrt nach Süden beinahe ersetzt. Aber kein Training an irgendeinem hiesigen Ort, kein Gewaltmarsch rund um den Maschsee (mit Rucksack, vierzig Kilogramm Steigeisen und sechzig Pfund eiserner Ration auf dem Rücken) kann als Einübung in die Beschaulichkeit gelten, die den erwartet, der in der Eigerwand wie am Glockenseil hängt.
Wichtig zu lernen: dass Aufstieg und Abstieg süßsauer eingemacht sind.
Dass das Edelweiß, das aus der Steinwand erblüht, beinah aus Filz und gekämmter Baumwolle ist, wie die Hüte, die unten im Talgrund auf den Häuptern der Tiroler ergrünen. Dass der Steinadler, der mit rauschender Schwinge den Nacken des Kletterers streift, ebensogut ein Schwalbenschwanz, ein wippender Schmetterling sein könnte. Aber dreh dich besser nicht um!
Wer Alpinist werden will, muss, um den Höhenrausch schwindelfrei zu genießen, beinah nichts andres tun, als Illusionen auf- und niederzubauen. Das fängt schon in der Tiefebene an. Nur so erklimmt man den Goldenen Schnitt im Bewusstsein, der Aufstieg und Abstieg verschmilzt und zur Kugel umgießt, auf der die Göttin der Glücks durch die Lüfte davoneilt.
Der Betrieb des Jonas Krimsmair, Betreiberjonas genannt, liegt hart an der Transitchaussee, wo sie in Serpentinen zum Pass hinaufführt. Krimsmairs Schlafkammer. Direkt auf die donnernde Straße geht’s hinaus, das abgeblätterte Fensterkreuz, unter dem die Laster mit Bananen und anderer Schmuggelware Nacht für Nacht passauf und passab donnern. Tieflader mit frisch geschlachteten Walen an Bord. Im Rotlicht der Rückleuchten sieht man den Tran auf den Asphalt hinabfließen, ein glänzendes Rinnsal, ein Faden, der sich an andere reiht. Ein Ölteppich, ein Läufer aus Schmiere und Fett, auf dem dann und wann, wie ein eingesetzter Rubin, eine achtlos von Bord geworfene Kippe erglüht.
Das kleine zweiäugige Glas, mit dem Krimsmair seit Mitternacht am Sims gestanden hat, hinter verschlossenen Scheiben, die vom Treiben der Laster zuweilen in klagenden Tönen erklirren, hängt nun an seiner Schlaufe vom Haken herab. Die Dämmerung naht und wirft ihr Licht in grauen Brocken nach drinnen. Die Scheinwerferstrahlen fingern, fahler und fahler geworden, noch immer über den Serpentinen entlang, absteigend zum Kälbertalgrund, zum Fernerpass aufsteigend. Jetzt sind sie mit bloßen Auge ganz deutlich zu sehen, die gewaltigen Hartgummipneus, die sich schwarz und von Feuchtigkeit glänzend im Frühnebel drehn, mit Rauschgift und Pressluft bis zum Bersten gefüllt. Sattelschlepper wuchten im Frachtraum Maschinen, Geschütze, heimlich montierte Stahlbrücken und Hafeneinfahrten von einer Kurve zur andren. Manchmal lugt ein Zipfel davon hervor.
Wieder eine ungeheure, weltgeschichtsträchtige Nacht kontrolliert!
Mit Schatten unter den Augen, Anflügen von Schatten an Wange und Kinn, sinkt jetzt der Betreiberjonas auf die Kante seines Bettes zurück Und während sich hinter seinem Rücken das mächtige Federbett staut, fährt er mit der Innenseite der Hand übers fliehende Kinn und hilft dann im Spiegel mit dem Rasiermesser nach, die dunklen Spuren seiner nächtlichen Wache zu tilgen. Das geht selten ohne Vergießen von Blut ab. Bartstoppeln und Seifenschaumberge landen unter Schaben und Knistern im Becken. Dazwischen rinnt es ab und zu rot. Das alles schwemmt ein kräftiger Bergwasserstrahl, den der Krimsmair per Hahn mit geübter Hand aufmacht und zudreht.
Der Süsterkogel und der Plater Schrofen bilden, aus der Luft, zum Beispiel aus einer Linienmaschine der Route Augsburg-Milano gesehen, eine logische Einheit. Der Passagier, der das Glück hat, einen Sitz am kreisrunden Fenster zu haben, wischt das beschlagene und von unsachgemäßer Behandlung leider schon ein wenig zerkratzte Plexiglas am besten mit seinem Brillentuch frei. Dann sieht er sie unter sich liegen, eine durch langgezogene Firne und Schneefelder logisch verbundene Gruppe.
Doch leider steckt hinter der vorderen noch eine hintere Seite, an die das Tüchlein nicht heranreicht. Winzige Gewächse aus Wasser, zu Nadeln zusammengefroren, hindern den Blick in die Tiefe. Im Rauschen der Turbinen dort draußen und im gleichförmigen Summen der Lüftung im Innern entschwebt das in der Bergwelt so umstrittene Massiv. Vielleicht hat der Süsterfranz doch recht, wenn er steif und fest meint, es sei auch der Logik entzogen. Was wir unter Logik verstehen, versteht er nicht ganz, aber im Kogl kennt er sich aus und erläutert der Fachwelt, wie dazu der Schrofen im Gegensatz steht.
Knappe Beschreibung des Kletterstiegs durch die Malgrieder Klamm:
Durch ein kurzes, aber senkrecht verlaufendes Waldstück gelangt man in den Einstiegskamin. Gute Markierung: ein sitzender Löwe, der seine Rechte zum Berggruß erhebt und infolge seiner flammenden Mähne auch nach Einbruch der Dunkelheit noch von den Baumstämmen und hervorspringenden Felskanten leuchtet.
Im Übergang zum Kamin die berüchtigte Steilflanke. Hier klinkt man sich ins Hängeseil ein und nimmt alle Gewandtheit zusammen, um in einem halbkreisförmigen Schwung Fuß auf der anderen Seite zu fassen. Einen ganz schmalen Sims gibt es dort, auf dem auch geübte Kaminsteiger selten gleich beim ersten Mal Fuß fassen. Falls es gelingt, entschädigt eine reizvolle Begrünung des Blicks für die überwundene Strapaze. In gigantischen Bärten und Polstern hängt aus dem Schacht, der den Ankömmling in regungsloser Miene fixiert, das grandiose Smaragdmoos.
Nun geht es mit Klammern und Steigeisen weiter. Wieder am Löwen vorbei. Nun auch er riesengroß, auf der Unterseite eines bedrohlich hervorspringenden Überhangs thronend. Die gestreckten Klauen und die lidlose Iris umgehen. Im Halbbogen – da empfiehlt sich’s zu robben – durch die schwefelgelb flammende Mähne hindurch. Ein urzeitlicher Übergang in den nun anschließenden oberen Teil des Kamins. Hier klettern die örtlichen Temperaturen, und zwar gerade im kältesten Winter und erlangen zuweilen tropische Werte. Wahrscheinlich eine vorgeschichtliche Feuerstelle, ein prähistorischer Verbrennungsort, der polythermische Materiallift unserer vorgeschichtlichen Ahnen.
Das Kaminende erreicht man zuletzt über dünne Steigleitern, wie wir sie aus den Schloten der inzwischen stillgelegten Hochöfen kennen. Ganz oben zwängen wir uns mit den Schultern durch die Öffnung hindurch, Bewundrer eines einmaligen Ausblicks, der weit über Höchst und die bedächtig qualmenden Farbwerke geht.
*) veröffentlicht in Gaismair Kalender 1994 von der Michael-Gaismaier-Gesellschaft Innsbruck (mit Unterstützung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport, der Kulturabteilung der Tiroler Landesregierung und der Stadt Innsbruck), S. 65 – 68